
Verbindlichkeit…

oder: Wer sich festlegt kommt besser voran.
Die Schnelllebigkeit unserer Zeit macht vor Yoga nicht Halt – das ist nichts Neues und auch wenn das erstmal nach Vorwurf klingt, hat es auch viel Positives in sich. Das Angebot an unterschiedlichen Stilen wird immer größer, jede/r kann einen passenden Stil eine/n passnde/n Lehrer:in finden, sich heraus picken, was er/sie gerade braucht.
Vielfältiges Ausprobieren
Viele Menschen lieben es, unterschiedliche Yoga-Veranstaltungen zu besuchen. Da gibt es eine tolle Location, dort super nachhaltige Yogakleidung und noch mal wo anders eine/n berühmte/n Lehrer:in, wo man vielleicht ein bisschen vom Glanz abbekommt. Das hat selbstverständlich alles seine Berechtigung, aber wo bleibt hier Yoga? Ist es Mittel zum Zweck für das nächste tolle Insta-Foto, für die Erzählung beim Fortgehen am Samstag Abend? Oder doch das Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung abseits der Bühne?
Sicher können auch einzelne Yogaevents auf eine bestimmte Weise in die Tiefe gehen und spirituelle Erfahrungen ermöglichen. Und nur weil der Yogalehrer gerne seinen Sixpack präsentiert, heißt das nicht, dass meine Konzentration davon abgelenkt wird. Vielleicht darf einfach beides sein – auch das Dranbleiben?
(Gesunde) Disziplin ist Verbindlichkeit ist Selbstfürsorge
In der Yogaphilosophie kennen wir den Begriff Abhyasa. Er wird z.B. in Patanjalis Yogasutren genannt und bedeutet “anhaltendes Üben, Disziplin”. Es wird empfohlen, in dieser Qualität zu üben. Wer schon länger Yoga praktiziert, hat wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, wie lohnend dieser Weg des anhaltenden Übens ist. Also dranzubleiben, sich zu verpflichten z.B. einmal wöchentlich in einen Kurs zu gehen, oder sogar zu Hause regelmäßig zu üben.
Nach einer Yogastunde kannst Du Dich schon einmal gelassen fühlen. Aber stell Dir vor, wie intensiv dieses Gefühl nach 10 Yogastunden ist! Dann gelingt es Dir auch im Alltag immer schneller gelassen zu sein. Dein Körper signalisiert Dir nach einer Einheit vielleicht, wie gut es ihm tut, einmal in alle Richtungen bewegt worden zu sein. Stell Dir vor, Du könntest ihm dieses Gefühl regelmäßig gönnen. Was wäre denn dann alles möglich?
Nach einer Yogastunde kannst Du zwar behaupten (wieder) eine/n neue/n Lehrer:in kennen gelernt zu haben. Aber stell Dir vor, Du würdest mit einem/r Lehrer:in viel tiefer eintauchen und Dich dabei sicher fühlen, ohne jedesmal wieder von vorne anzufangen. Stell Dir vor, Du hättest eine/n Lehrer:in, der/die Dich und Deinen Körper kennt. Dich automatisch im richtigen Zeitpunkt erinnert, jetzt noch ein bisschen durchzuhalten oder auch rechtzeitig aufzuhören. Dir bei den richtigen Asanas Unterstützung gibt, auf die Weise, wie Du es magst. Dir Alternativen anbietet, weil er/sie weiß, für Dich ist das so gerade nützlicher.
Der Nutzen von Verbindlichkeit
Dein Körper und Dein Geist werden es Dir danken, wenn Du Dich für eine regelmäßige Praxis entscheidest. Wenn Du übst, auch wenn es Dich gerade nicht freut. Du musst das nicht alleine tun – ganz viele Yogalehrer:innen freuen sich, wenn Du Dich für ihre Unterstützung entscheidest. Es ist nämlich meistens eine Herzensangelegenheit, Dich zu begleiten, und wunderschön zu sehen, wie Du Dich wirklich vertiefst, lernst und zu strahlen beginnst.
Und lass‘ uns die Vorfreude nicht vergessen! Du verpflichtest Dich ja nicht für etwas, was Du nicht magst. Du versprichst Dir selbst, von etwas, was Dir gut tut und Freude bereitet, regelmäßig mehr zu machen und davon zu profitieren. So kannst Du Dich jedesmal auf einen Termin oder auf das Gefühl danach freuen!
Wer sich festlegt, kommt besser voran.


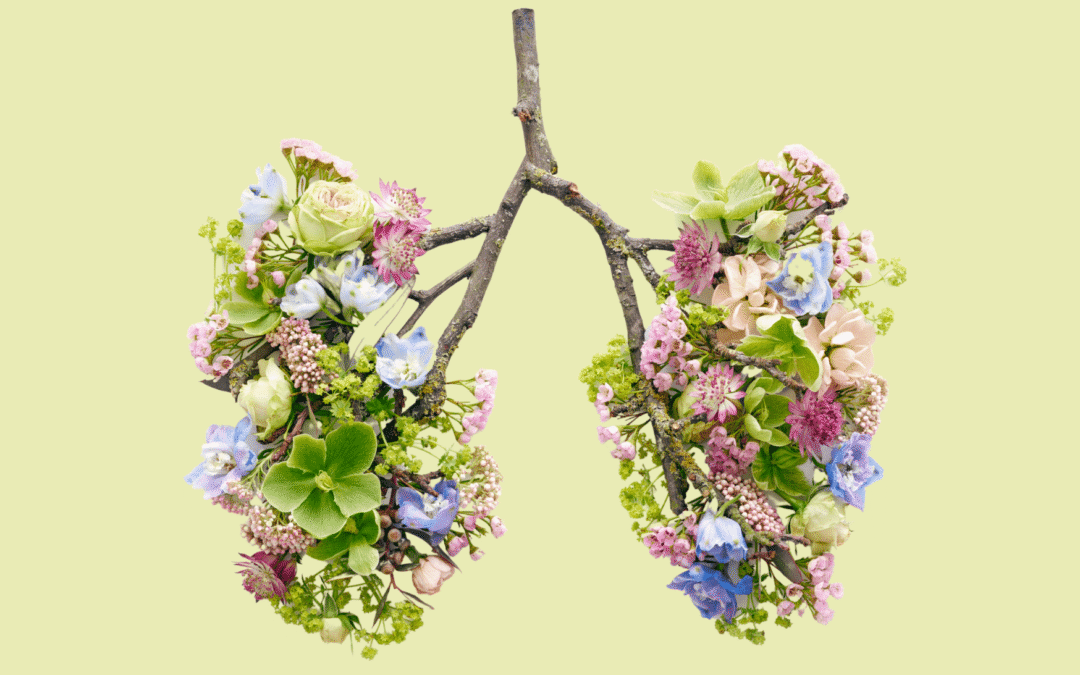
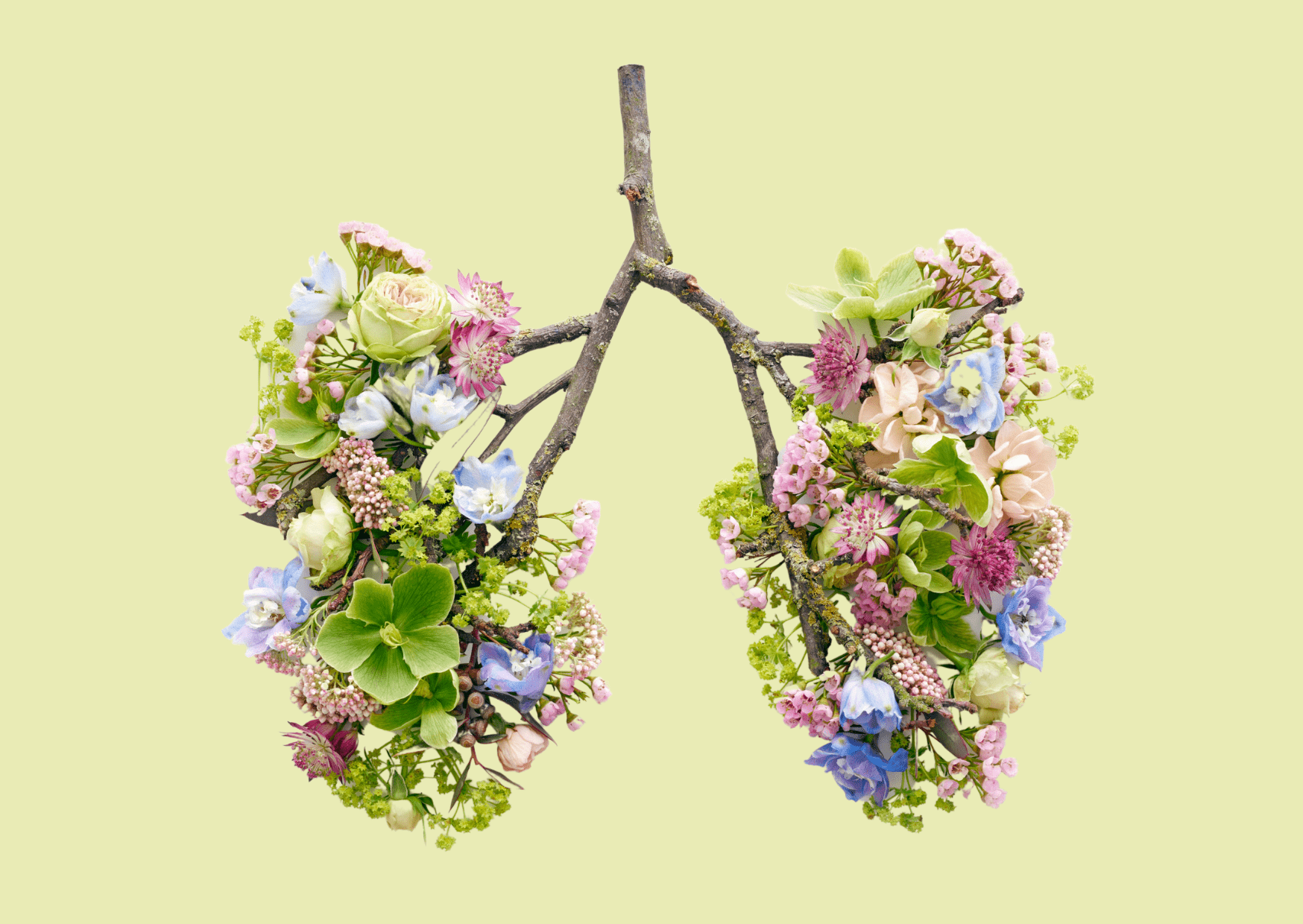







Neueste Kommentare